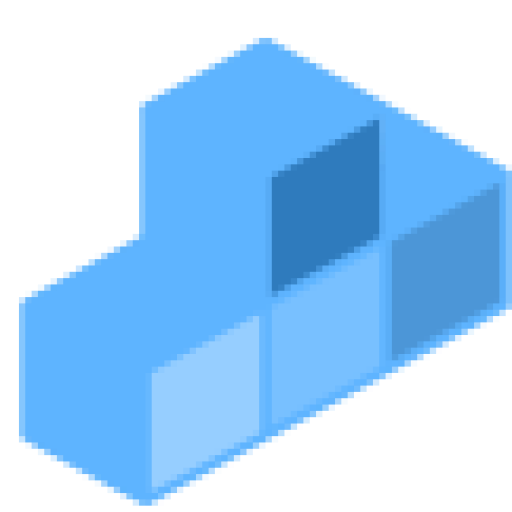„Jazz ist tot“, den Satz hat man vielleicht schon bereits einmal gehört, wenn man sich mit einem Freund in einer Bar oder sonst wo über Musik tiefgehender unterhalten hat und doch ist sie in Filmen wie James Bond oder auf Galas omnipräsent und verleiht der Szenerie eine passende seriöse und elegante Atmosphäre. Miles Davis, mit seinem Hit „So What“, Dave Bruback mit „Take Five“ oder auch „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong dürfte in den Köpfen der allermeisten Menschen präsent sein, auch wenn die Titel für die meisten gerade mit einem großen Fragezeichen hinterlegt sind – jeder hat zumindest einen Hit davon schon mal im Radio oder in einem Film gehört.
Der Film Whiplash gibt der Musikwelt endlich einen wichtigen Film, wie hart das Business für Musiker ist und vermittelt par excellence Emotionen sowie den Ehrgeiz eines aufstrebenden jungen Studenten namens Andrew, der es in der Jazzwelt weit bringen möchte. J.K. Simmons, auch vielen bekannt als der cholerische Chefredakteur J. Jonah Jameson aus den Spiderman-Filmen mit Tobey Maguire und Tom Holland, spielt seine Rolle als sadistischen Lehrer in der fiktiven Conservatory of Music in New York tadellos.
Es fällt einem als Rezipienten schwer ihn komplett zu hassen und gleichzeitig gestaltet es sich im selben Maße schwierig Sympathie zum Antagonisten aufzubauen. Immerhin wirft er Stühle nach seinen Studenten, beleidigt sie in einer unmöglichen Manier und hat diese Art von Ansprüchen, bei denen es heißt „Gut ist nicht gut genug“. Zugegeben musste ich an vielen Stellen, an denen der Leiter der Hochschulband die Kommilitonen beleidigt hatte lachen, einfach, weil die Art und Weiße sowie die Wortwahl unerwartet präzise gewählt sind und jeder Schuss sitzt. Als ein Ex-Student von ihm vermeintlich bei einem Autounfall verstirbt, der es nach seinem Studium weit gebracht hatte, zeigt sich der Dozent emotional und zu Tränen gerührt, was ihn mehr als nur einen eindimensionalen Charakter macht, der lediglich seine Studenten beschimpft. Außerdem erklärt er Andrew später, wieso er zu solchen fiesen Lehrmethoden zurückgreift, da in längst vergangen Tagen ein Jazzmusiker einst ein Becken an den Kopf geworfen bekam, weil seine Leistungen nicht ausreichten. Dies spornte ihn daraufhin dazu an weiter zu üben und besser zu werden, woraufhin er dann eine Top Performance hinlegte und aufgrund dessen weltberühmt wurde. Der nächste erfolgreiche Virtuose könne laut ihm also nicht mit einem einfachen „Gut gemacht“ zu einer unvergleichlichen Leistung bringen, man solle ihn an seine Grenzen bringen und dies ist nur mit aller Härte möglich.
Man müsste jedes mal, wie im Film „Django Unchained“, wenn Fletcher etwas vulgäres sagt oder Mobiliar nach den Studenten wirft einen Shot trinken. Das würde ich jedoch beim zweiten Mal empfehlen, da man den Film beim ersten Mal doch nüchtern angeschaut haben sollte, weil er Schnitttechnisch und im Dialog so unfassbar wertvoll ist und zeigt, wie wichtig der Ehrgeiz neben Talent ist, wenn man Erfolg haben möchte.
Der Protagonist Andrew Neiman (Miles Teller) muss im ersten Semester die perfiden Methoden von Fletcher (J.K. Simmons) nun also ertragen. Anfänglich verschaut er sich in eine hübsche Studentin, die jedoch nicht so recht weiß, welche Fächerkombination sie wählen möchte und im Vergleich zu ihm kein richtiges Ziel vor Augen hat. Andrew hingegen weiß genau, was er will: Er will der beste Jazz-Schlagzeuger werden, den die Welt je gesehen hat. Doch je mehr er sich in Fletchers brutale Welt aus Disziplin, Demütigung und unmenschlichen Anforderungen begibt, desto mehr verliert er die Kontrolle über sein Leben. Seine Freundschaften und seine Beziehung leiden unter seinem unaufhörlichen Drang nach Perfektion, und bald bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich vollkommen auf seine Karriere zu fokussieren. In einer emotional aufwühlenden Szene beendet Andrew sogar seine Beziehung zu der Studentin, da er glaubt, sie würde ihn von seinen Zielen ablenken.
Die Intensität des Films erreicht ihren Höhepunkt, als Andrew nach einer nervenaufreibenden Reihe von Proben bei einem wichtigen Konzert vollkommen erschöpft und am Rande eines Zusammenbruchs steht. Eine Autopanne bringt ihn in eine katastrophale Situation, die seine gesamte Karriere gefährden könnte. Doch statt aufzugeben, kämpft er sich trotz seiner körperlichen und mentalen Erschöpfung weiter durch.
Der Film endet in einem fesselnden Finale, in dem Andrew und Fletcher auf der Bühne in einem wortlosen, aber emotional aufgeladenen Duell stehen. In diesem Moment wird deutlich, dass beide mehr als nur Lehrer und Schüler sind – sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Andrew, getrieben von seinem Drang, der Beste zu sein, und Fletcher, der davon überzeugt ist, dass nur äußerste Härte zu wahrer Größe führt, liefern eine Performance ab, die sowohl zerstörerisch als auch beeindruckend ist.
„Whiplash“ zeigt eindringlich die Schattenseiten des Perfektionismus und hinterfragt gleichzeitig, was es wirklich bedeutet, erfolgreich zu sein. Kann man Größe nur erreichen, wenn man sich selbst und seine Mitmenschen bis an die Grenze des Erträglichen treibt? Oder gibt es einen Punkt, an dem Ehrgeiz und Selbstaufopferung ins Destruktive umschlagen?
Für Jazzliebhaber und Filmfans gleichermaßen ist „Whiplash“ nicht nur ein Meisterwerk, sondern eine erschütternde Reflexion über den Preis des Erfolgs. Die Darstellungen von Miles Teller und J.K. Simmons sind absolut mitreißend, und die Musik, die den gesamten Film durchzieht, ist kraftvoll und präzise eingesetzt. Dieser Film lässt keinen Zuschauer unberührt und zwingt uns, über die Natur von Talent, harter Arbeit und dem Streben nach Perfektion nachzudenken.
Fazit:
„Whiplash“ ist weit mehr als ein Film über Musik. Es ist ein tiefgehendes Drama über die Obsession nach Größe, die Opfer, die man auf dem Weg dorthin bringt, und die unerbittliche Jagd nach Anerkennung. Jazz ist vielleicht nicht tot – aber der Weg zur Perfektion in dieser Welt ist mit Sicherheit kein leichter.